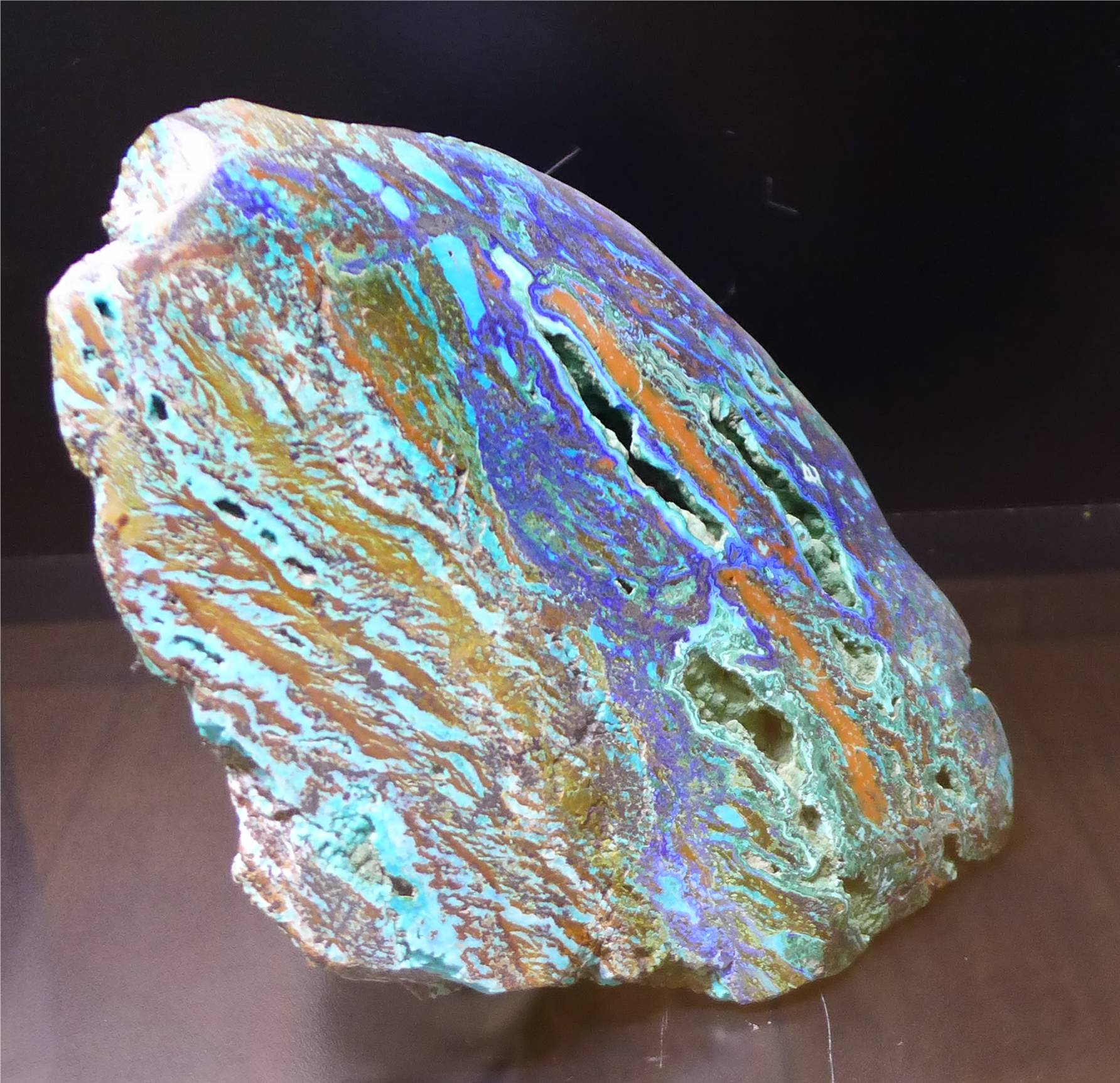Gestern Abend (Tag 10) hatten wir das erste Mal seit Tagen einen fast wolkenlosen Himmel und einen gold-roten Sonnenuntergang, der von einem „green flash“ gekrönt wurde. Wenn die Sonne gerade untergegangen ist, kann es zu diesem grünen Aufleuchten kommen. Das Sonnenlicht leuchtet quasi schräg von unten durch die Wasseroberfläche.
Das war bereits der zweite green flash dieser Überfahrt. Bereits am Samstag (Tag 5) durften wir ihn sehen. Voraussetzung ist, dass die Sonne über dem Meer untergeht und nicht über Land, ein klarer Himmel im Westen und gute Sicht auf den Horizont (also kein zu hoher Seegang).
In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben wir 8° östlicher Länge überquert. Das ist der Längengrad der durch Bremerhaven und durchs Klimahaus führt. Damit sind wir über alle Längengrade gesegelt und haben einen ersten Hinweis darauf gesammelt, dass es sich bei der Erde um eine Kugel handeln könnte. Darauf trinken wir eine extra Kanne Tee. Allerdings erst mittags, als wir bereits an Emden vorbei sind. Längengrad-mäßig.
Gegen Mittag nimmt der Wind langsam zu und dreht etwas achterlicher, wir baumen die Fock an Steuerbord aus. Nur kurz zeigt sich die Sonne, dann bezieht es sich. Nachmittags bekommen wir Besuch von sehr vielen Delfinen.
In der Nacht auf Montag haben wir immer wieder Böen mit 6-7 Bft und schnell entwickelt sich eine ruppig Welle. Insgesamt ist das aber alles unspektakulär, die Welle ist nicht sehr hoch und der Wind hält sich an den Wetterbericht.
Wir haben die Schifffahrtsroute gefunden. Immer wieder kreuzen große Schiffe unseren Kurs. Unterwegs nach Rotterdam, Singapur, oder China.
Montag lässt der Wind langsam nach, die Welle bleibt und sorgt gelegentlich für ein ziemliches Geschaukel. Es gibt Kartoffeln und gebratene Zucchini, die versuchen aus der Pfanne zu springen.
Der Dienstag ist wieder flau. Wir lassen den Motor eine Stunde laufen und schmeißen den Wassermacher an. Wir halten uns mit einer Dusche, gelben Curry und Pudding bei Laune. „Immerhin fahren wir in die richtige Richtung“ ist der Slogan dieser Überfahrt.
Uns fällt auf, dass wir seit Tagen keine Albatrosse mehr gesehen haben. In den ersten Tagen haben sie uns häufig begleitet und wir mochten ihnen stundenlang zusehen. Anscheinend haben wir ihre bevorzugten Gebiete verlassen.
Mittwochmorgen ist es grau. Dunkle Wolken umringen uns und der Wind ist böig. Kaum rolle ich die Fock weiter aus, weil wir langsam sind, rauschen ein paar Böen heran. Verkleinere ich die Fock, lässt der Wind wieder nach.
Nachts hat es das erste Mal gereget. Prinzipiell habe ich keine Lust auf Regen, ein kräftiger Schauer als Schiffswaschanlage wäre aber willkommen. Mari ist nicht nur salzverkrustet, sondern auch bedeckt mit Namib Sand und Dreck aus Südafrika. Unsere ehemals weißen Schoten sind dunkelgrau.
Gegen Mittag lässt der Wind nach, wir sind wieder langsam und ich backe einen Apfelkuchen, der insbesondere während der Nachtwachen sehr populär ist.
Ganz ruhig gleiten wir durch die Nacht. Wir haben wenig Wind, aber auch kaum Welle. Es ist bedeckt, doch die Wolkendecke scheint dünn zu sein. Der Mond, den ich nicht sehen kann, taucht alles in ein fahles Licht.
Auch Donnerstag (20. März, Tag 10) ist es wieder grau . Ein bisschen Sonne wäre gut fürs Gemüt und für den Energiegaushalt. Vormittags schläft der leichte Wind ein. Schließlich ziehen wir die Segellatten aus dem Groß. Wir können das Klatschen und Scheppern des Segels, das sich in der leichten Dünung von einer Seite zur anderen wirft, nicht mehr ertragen. In der Flaute die gute Laune zu behalten ist nicht ganz einfach, wir möchten vorankommen – wenigstens langsam. Auf dieser Etappe hatten wir auf stabile Passatwinde gehofft und nicht mit so wenig Wind und so vielen Winddrehern gerechnet. Wir versuchen die Stille zu genießen (wenn das Segel sich ruhig verhält) und die Weite des Meeres. Sind wir schon oder erst zehn Tage unterwegs? Nachtwachen, Sonnenuntergänge und Kurswechsel, alles verschwimmt. Uns geht’s gut hier draußen, dann brauchen wir eben etwas länger. Ich backe ein Brot, Nobbi putzt ein bisschen und bearbeitet Fotos.
Mittags setzt sich endlich die Sonne durch und wir gehen baden. Irgendwelche Vorteile muss die Flaute ja haben. Außerdem gibt es schon wieder einen Grund zu feiern. Vormittags sind wir über den Greenwich Meridian, den 0. Längengrad, gesegelt und sind damit nun wieder im Westen. Neptun bekommt auch einen Schluck Rum. Sicher ist sicher.
Leider müssen wir feststellen, dass eines unserer Solarpanels wohl den Geist aufgegeben hat. Das ist sehr ärgerlich und nicht gut für die Energiebilanz. Vor drei Tagen hat es uns noch ganz normal mit Strom versorgt.
Heute Nacht gleiten wir fast lautlos langsam nach Westen. Immer wieder besuchen uns die eiligen Define, die gerne vorbeischauen, aber nie lange bleiben. Bei Wachübergabe um vier hören wir plötzlich ein merkwürdiges Geräusch es sprudelt und klatscht. Mein erster Gedanke ist, regnet es? Nein, das ist das Geräusch wenn man durch einen großen Fischschwarm segelt.
Wenig später frischt der Wind auf. Von zwei Windstärken auf fünf, ich freue mich, über die Geschwindigkeit. Dann fallen die ersten Böen ein, also verkleinere ich das Vorsegel. Die Wolken türmen sich dunkelgrau am Himmel. Zwei Stunden später haben wir wieder flaue zwei Windstärken, die Wolken lösen sich auf und die Sonne scheint.