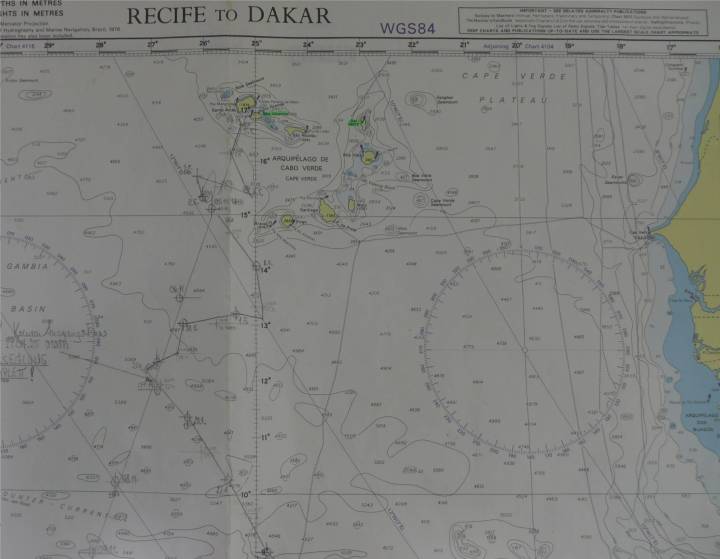Mindelo ist die zweitgrößte Stadt der Kapverden und hat (mit den angrenzenden Vororten) etwa 80.000 Einwohner. Wir fühlen uns wohl in der lebendigen, bunten, kleinen Stadt. Es herrscht eine entspannte und freundliche Stimmung.
Seit unserem letzten Besuch 2017 hat sich einiges verändert, es gibt paar neue Häuser und der Hafen wurde vergrößert. Der größte Unterschied für uns ist, dass es so leer ist. Cabo Verde wird vor allem von Seglern auf dem Weg von Europa in die Karibik angelaufen. Die Hauptsaison ist im Herbst und Winter. Nun sind Ankerplatz und Marina recht leer. In der Floating Bar ist es trotzdem immer voll und einige Segler sind auch unterwegs, so dass wir nette Leute treffen.
Häuser und Straßen scheinen weitgehend in recht gutem Zustand zu sein und es wird viel gebaut. Arbeit ist das Problem. Nicht mal zwei Wochen sind wir hier und haben schon in viele Gesprächen gehört, dass es keine Arbeit gibt. Junge Leute zieht es ins Ausland, besonders nach Portugal. Auf die knapp 600.000 Einwohner (die Angaben variieren überraschend stark), kommen je nach Quelle 700.000 bis 1 Mio. Kapverdier die im Ausland leben. Das Geld, das die im Ausland lebenden Menschen ihren Familien schicken macht ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukts aus.
Von unserem Liegeplatz haben wir einen guten Blick über die Bucht und sehen, dass viele interessante Schiffe in Mindelo einen Stopp einlegen. Der Hafen wird von kleinen topmodernen Containerschiffen und von alten Frachtern angelaufen. Ich freue mich besonders, das „mein“ kleiner blauer Frachter „Conceicão Maria“, den ich vor sieben Jahren mit einem Pferd an Deck in Sal gesehen habe, noch immer in Betrieb ist. Ein Großsegler legt einen Stopp ein und luxuriöse Sportfischer, die Marlins fangen wollen, bleiben für einige Wochen in der Marina. Große Tanker werden im Süden der Bucht verankert, sie bringen Treibstoff.
Viele Schiffe legen nur für einen Tankstopp in Mindelo ein, fast die Hälfte der Exporteinnahmen soll aus dem Treibstoffverkauf an Schiffe und Flugzeuge (auf Sal) stammen. Und so stoppen fast jeden Tag interessante Schiffe für einige Stunden in der Bucht: Luxusyachten im James Bond Stil, ein nagelneues Hybridschiff, Forschungsschiffe, ein tauchbarer Spezialtransporter oder ein Schiff mit Windgeneratorflügeln an Deck, aber auch ganz normale Tanker (ja, auch Tanker müssen tanken!) und große Bulkcarrier. Wir haben das Fernglas immer griffbereit.


Neben dem Ausschlafen stehen kleine Erledigungen auf dem Programm. Hier gibt’s was zu kleben, dort ein Gummiband zu ersetzen. Mit Oxalsäure entfernen wir wenigstens einige Rostflecken, der lange schwarze Streifen, den das Taxiboot von St. Helena auf unserem Rumpf hinterlassen hat lässt sich leicht wegrubbeln. Ein paar Druckknöpfe wollen angenäht werden, an Nobbis Nachwachen-Pullover sind mehrere Nähte aufgegangen, der Wolljacke fehlt der Aufhänger und die Lieblings-Einkaufstasche hat einen Henkel verloren.
Nach mehreren Putz-Schnorcheltauchgängen ist das Unterwasserschiff wieder recht sauber, da werden wir kurz vor der Abfahrt noch einmal nacharbeiten. Die Nähte am Bimini zu flicken war einfach, das Nähen der Sprayhood ungemütlich und das Ergebnis ist nur mäßig befriedigend. Die Sprayhood reißt an der Vorderkante. Eigentlich müssten wir sie abbauen, haben aber Angst, dass sie dann an weiteren Stellen kaputt geht. Also nähen wir einen Flicken auf die kaputte Stelle. Nobbi sitzt an Deck, ich nähe über Kopf aus dem Niedergang. Wir hatten gedacht, wir könnten ein Hörbuch hören, während wir arbeiten. Bei sechs Windstärken sind wir froh, wenn wir einander verstehen. Besonders schön ist die Reparatur nicht geworden. Gerne würden wir die Naht mit einem Tape schützen, aber keins der getesteten Klebestreifen hält. Das alte Problem.
Manche Jobs sind schnell erledigt. Der Motor bekommt seinen verdienten Ölwechsel. Angenehmer Nebeneffekt: der Ölkanister, der leider nicht dicht war, verschwindet aus der Bilge. Über das Öl in der Bilge, das sich bei Schräglage ganz wunderbar verteilt hatte, hatten wir uns schon vor Wochen gefreut. Wir putzen mal wieder die Bilge. Das ist inzwischen einfacher geworden, weil wir die dort lagernden Getränke ausgetrunken haben.
Der Traveller, dort ist die Großschot angeschlagen, wurde überholt. Einige Schrauben hatten Anstalten gemacht einige Wege zu gehen.
Marisol ist auch wieder ein wenig leichter geworden. 30 Meter unserer Ankerkette haben wir abgesägt (66kg Gewichtsersparnis!!) und noch bevor wir überlegen konnten was wir mit diesem Rest machen, hatte dieser einen neuen Besitzer gefunden. Wir haben beschlossen, dass die nächsten Ankerplätze weniger tief sein werden und uns 70 Meter Kette ausreichen müssen.
Nahe des Hafens ist nicht nur der Markt, sondern sind auch mehrere Supermärkte, hier füllen wir unsere Vorräte auf. Die Gasflasche zu füllen gestaltet sich als denkbar einfach und ausgesprochen günstig, die Dieselvorräte stocken wir an der Wassertankstelle in der Marina auf und Elisabeth holt die Wäsche ab und bringt sie schon bald trocken und duftend zurück. Den Kleinkram und alles, was nicht in den Trockner möchte, waschen wir mit der Hand, dank der trocknen Luft kann es in den Schrank, kaum dass es auf der Leine hängt.







Ganz wichtig ist das Touri-Programm zwischendurch. Wir besuchen das kleine maritime Museum im Torre Belem. Im Nachbau des Lissabonner Turms gibt es einige Exponate von Wracks zusehen. Die kleine Ausstellung ist gepflegt und zweisprachig. Noch besser gefallen uns die Fotoausstellung mit Fotos vom Fischmarkt und der tolle Ausblick über die Bucht und die Stadt.
Das CNAD, das Kunst- und Designmuseum, zieht uns mit seiner tollen Fassade an. Hinter einem alten Gebäude steht ein Neubau mit einer ganz tollen Fassade aus bunten Ölfassdeckeln. Mir gefällt besonders die Fischausstellung, aus gefärbten Fischhäuten wurden ganz verschiedene Fische, Handtaschen, Schuhe, Schmuck und weitere Gegenstände gefertigt. Das Café des Museums ist übrigens auch sehr zu empfehlen, hier gibt es auch den extrem leckeren Kaffee von Fogo (einer der südlichen Inseln).






Nobbi muss dringend zum Frisör. In der Marina hatten wir uns schon einen Stromkasten ausgeguckt auf dem er sitzen könnte, während ich ihn frisiere. Dann kommen wir auf einer Runde durch die Stadt an einem Frisör vorbei und Nobbi lässt sich kurz entschlossen die Haare schneiden. Es lässt sich nicht anders sagen, das war eine Katastrophe. Der schlechteste Haarschnitt der Reise. Das hätte ich nicht schlechter gekonnt.
Eine Fischvergiftung, eine doofe Magen-Darm-Geschichte und Fieber haben uns aufgestoppt. Erst bin ich ausgefallen, dann war Nobbi außer Betrieb. Es gab ein kleines Déjà-vu von 2017, da war ich auch immer wieder krank. Mein Magen scheint nur begrenzt Cabo Verde tauglich zu sein.
Jetzt sind wir beide wieder fit und bereit für neue Abenteuer (kleine Abenteuer bitte, keine zu großen!).