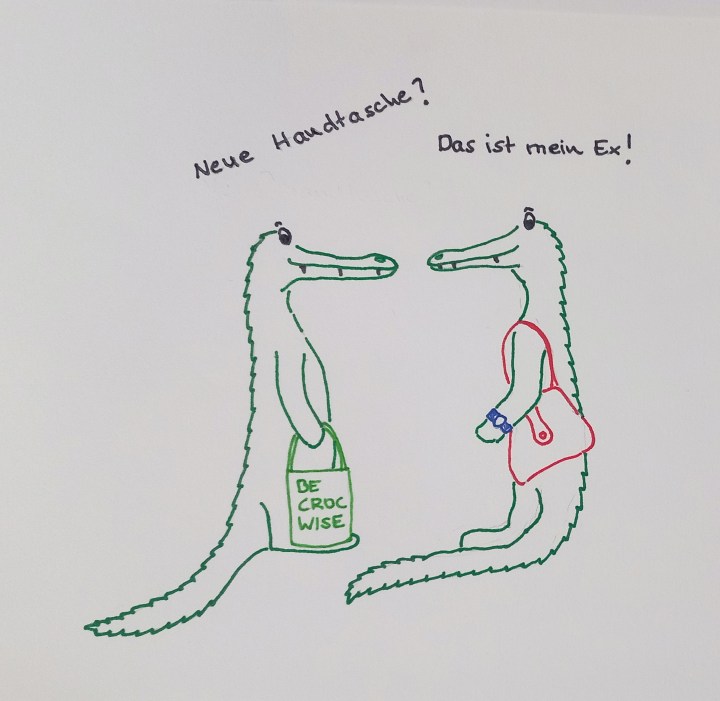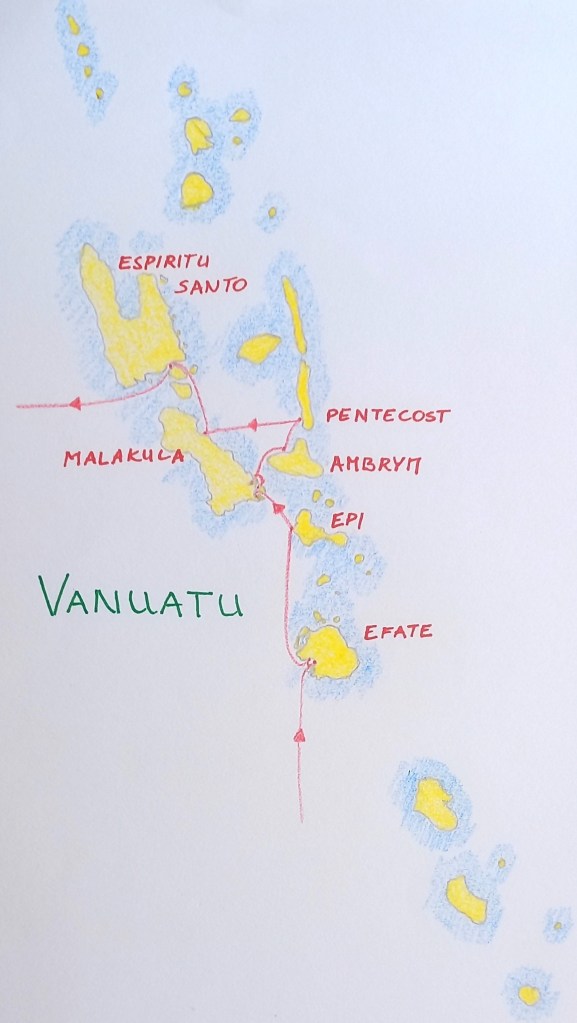Osttimor ist ein junges Land mit einer jungen Bevölkerung. Erst 2002 wurde Osttimor endgültig Unabhängig und das Medianalter der 1,3 Mio. Einwohner liegt bei etwa 20 Jahren. Portugiesisch und Tetum sind die offiziellen Sprachen, es werden jedoch viele weitere lokale Sprachen, außerdem Indonesisch und Englisch gesprochen. Praktisch alle Bewohner, ungefähr 98 %, sind katholisch, das liegt vor allem an der Rolle der katholischen Kirche während der indonesischen Besetzung. Gezahlt wird mit US-Dollar, ähnlich wie in Panama gibt es eigene Münzen.
Osttimor umfasst den Ostteil der Insel Timors (wer hätte das gedacht), die Exklave Oecusse weiter im Westen der Insel Timor und zwei kleine Inseln. Die Größe von 15.000 km2 entspricht etwa der Größe Schleswig-Holsteins. Und, ein wenig unnützes Quizshow-Wissen, Osttimor ist das einzige asiatische Land, das ausschließlich auf der Südhalbkugel liegt.
Dili ist die Hauptstadt und liegt an der Nordküste der Insel. Und mitten im Herzen der Stadt, gegenüber vom Regierungspalast, liegen wir. Unser Ankerplatz ist mäßig romantisch, dafür aber sehr zentral. Uns gefällt es hier.
Am Sonntag, am Tag nach unserer Ankunft, pumpen wir unser Dinghi auf und fahren an Land. Bei der Policia Maritima gibt es einen Strand, dort können wir anlanden. Wegen des leichten Schwells, brauchen wir ein gutes Timing beim Sprung auf den Strand.
Bei der Policia Maritima interessiert sich niemand für uns, es wird geangelt und Billard gespielt. Schließlich ist Wochenende. Bei der Immigration treffen wir, wie erwartet niemanden an. Wir genehmigen uns unseren Landgang selbst und fahren mit dem Taxi ins Timor Plaza Einkaufszentrum, kaufen SIM Karten samt Datenpaket und essen dort.
Am Montag melden wir uns bei der Policia Maritima, wir dürfen unser Boot gerne an ihrem Strand lassen, und sollen zur Immigration am Hafen gehen. Dort schickt man uns zur Gesundheitsbehörde. In einem kleinen Büro füllen wir ein Formular aus, unsere Impfpässe werden begutachtet und eine Crewliste abgestempelt. Der Chef kommt auch noch vorbei und möchte sich ein wenig unterhalten. Zurück zur Immigration. Dort liegen schon die zwei Einreiseformulare für uns bereit, die ich ausfülle, während Nobbi sich mit den Beamten unterhält. Werder Bremen ist bekannt, Borussia Dortmund findet man sympathisch. Die Pässe werden gestempelt, außerdem auch wieder eine Crewliste. Nobbi zieht unseren Bootsstempel raus und stempelt die Crewliste ebenfalls, das stößt auf große Begeisterung. Wir sollen nun zum Hafenmeister gehen. Ob wir nicht auch zum Zoll müssen? Stimmt, erst zum Zoll. Beim Zoll ist keiner, der uns abfertigen darf. Wir sollen zum neuen Handelshafen fahren. Das wollen wir nicht so gern, das ist 15km entfernt und wir sind nicht so sicher, wo wir da genau hinfahren sollen. Also gehen wir erstmal zum Hafenmeister, der nette Immigration-Beamte schleust uns in den Sicherheitsbereich des Hafens, wir können die Abkürzung nehmen. Dort beschäftigen wir gleich drei Beamte, ob wir eine Crewliste hätten? Wieder füllen wir ein Formular aus, unsere Pässe werden kopiert. Wir erzählen, dass wir zum Zoll im Handelshafen fahren sollen. Der Hafenmeister findet das zu teuer und zu gefährlich. Nachmittags sei doch sicherlich ein Beamter dort. Wir geraten in ein Büro der Hafendirektion, ob wir schon beim Hafenmeister waren und ob wir einen Beleg bekommen haben? Ob wir den Beleg nicht erst bei der Abreise bekommen, fragen wir. Ein Telefonat bringt Klärung und man ist sich einig, den Beleg gibt’s bei der Ausreise und wir sollen nicht zum Handelshafen fahren. Wir gehen wieder zum Zoll, der Mitarbeiter ruft seinen Chef an und bespricht mit ihm, dass wir nachmittags wiederkommen. Als wir zurückkehren liegt das Zollformular unterschrieben bereit, wir brauchen es nur noch auszufüllen, in der Hafendirektion wird es kopiert und schon sind wir einklariert.
Das ganze Prozedere war etwas chaotisch, aber alle die wir getroffen haben waren freundlich und bemüht. Alle Stationen sind nur wenige Meter voneinander entfernt. Unsere wenigen Portugiesisch Bruchstücke haben manches Lächeln hervorgerufen und Geduld und Freundlichkeit, wie so oft, weitergeholfen. Gestern waren wir auf dem Hafengelände um ein Foto zu machen und werden sehr enthusiastisch begrüßt, da darf man mich dann sogar Mami nennen.
Man kann hier überraschend gut einkaufen. Schade, dass wir so gut proviantiert sind und eigentlich gar nichts brauchen. Besonders angetan hat es uns der portugiesische Supermarkt. Wir genießen wunderbare Pasteis de Nata, die tollen portugisischen Törtchen, spanischen Käse und portugiesischen Rotwein. Außerdem kann man hier auch nett Mittagsessen.
Auf dem Gemüsemarkt müssen wir uns für einen Stand entscheiden, die Auswahl ist groß. Eine sympathische junge Frau macht das Rennen. Wassermelone, Maracuja, Bananen, Tomaten und Gurken wandern in unsere Tasche. Die junge Frau ist geschäftstüchtig und möchte uns auch Mangos, Ananas und Soursop verkaufen, wieder versprechen wiederzukommen, wenn wir aufgegessen haben.
Wir bummeln an der Promenade entlang wundern uns über die unzähligen Stände mit exakt identischem Warenangebot nebeneinander und beobachten das Leben. Junge Männer bieten Handyreparaturen an, magere Katzen warten auf die Reste aus den Garküchen und überall gibt es Kokosnussverkäufer. Nobbi war beim Friseur und der Haarschnitt ist ganz gut geworden, besonders wenn man bedenkt, dass er mit einer Küchenschere und einem kaum funktionierenden Haarschneider gemacht wurde.
Die Fischer kommen rein, laden ihre Fische ab und versorgen sich mit Lebensmittel und Wasser. Wir wollen uns das Spektakel von nahem ansehen, aber es stinkt höllisch. Im flachen Wasser werden die Fische ausgenommen, sortiert und gewogen.
Die Kanalisation ergießt sich ins Meer und der Strand ist dreckig. Plastikmüll. Ums Schiff ist es dank des starken Wasseraustausches erstaunlich sauber und wir sehen immer wieder Schildkröten neben dem Boot. Ich muss hier aber nicht baden. Osttimor soll viele fantastische, unberührte Strände haben, dass der vor der Hauptstadt nicht dazugehört, ist wenig überraschend. Im Zentrum der Stadt ist es erstaunlich sauber, die Fusswege sind frisch gefegt und die Rinnsteine wurden von Müll befreit, entfernt man sich etwas weiter sieht es anders aus. Vielleicht kommt es aber auch nur drauf an, wo die Stadtreinigung gerade unterwegs war.
Mittags kommt etwas Thermik auf und der Seegang nimmt zu, deshalb sind Dinghifahrten um die Mittagszeit ein wenig sportlicher, morgens und abends ist es meist sehr ruhig. Wir waren jetzt jeden Tag mittags unterwegs und sind immer heil an den Strand und wieder zurück an Bord gekommen. Wenn der Wind abends nachlässt, legt Mari sich gerne quer zum Schwell und schaukelt dann etwas oder auch etwas mehr. Ab und zu muss man sein Glas festhalten, damit es nicht vom Tisch hüpft. Wir haben überlegt einen Heckanker zu setzen, uns dann aber dagegen entschieden. Eigentlich wollen wir bald weitersegeln, gerade fühlen wir uns aber sehr wohl hier.